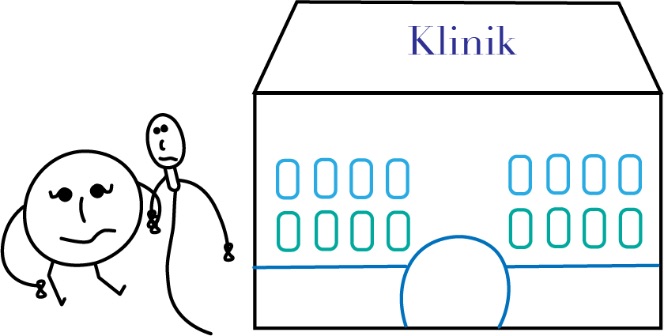Inhalt
Meine Ausschabung und wie es mir dabei erging...
Es ist der 22.11.2013 an dem ich morgens gegen 7:00 zusammen mit meiner Mutter in die Tagesklinik Altonaer Straße fahre.
Heute habe ich den Termin zur Ausschabung und ich bin so froh, dass meine Mutter mich an diesem Tag begleitet. Zu diesem Zeitpunkt war es gerade einmal die dritte Vollnarkose in meinem Leben und bisher machte mir diese Situation immer noch eine ganze Menge Angst. Auch wenn man weiß, dass man sich in die Hände von Profis begibt, war mir doch bewusst, dass es auch bei Profis immer ein Restrisiko gibt. Ausserdem hatte ich immer noch mit der Sorge zu kämpfen, dass bei der OP etwas schief laufen könnte und sich die Chancen auf unser eigenes Kind damit noch weiter verschlechtern würden.
Hier kannst Du dir die Podcastfolge anhören:
Warten, warten, warten…
Warum auch immer, aber meine Mutter und ich hatten irgendwie die Vorstellung, dass in der Klinik nicht viel los wäre (7:00 fanden wir als Termin auch ganz schön früh…). Wir kamen gerade noch pünktlich, da wir zuerst in die Kinderwunschklinik gestolpert sind, die ihren Sitz im gleichen Gebäude hat. Dann haben wir die Tagesklinik endlich gefunden: das Wartezimmer (das etwa 35 Leute fasst) ist bis auf zwei Plätze komplett voll. Wir haben also gerade noch Glück, sind aber von diesem Andrang ziemlich überrascht. Besonders kommen auch nach uns fast minütlich weitere Patientinnen.
Ich bekomme von der Sprechstundenhilfe ungefähr 5 verschiedene Formulare, die ich lesen und ausfüllen soll. Ich muss zugeben, dass es nicht gerade angenehm ist, sich vor diesem Eingriff auch noch alle möglichen Komplikationen und den genauen Ablauf der Prozedur durchzulesen. Trotzdem möchte ich heute den nächsten Schritt gehen, ich möchte endlich wieder nach Vorne schauen können und das Erlebte langsam verarbeiten.
Ich fülle alle Unterlagen aus und gebe sie wieder bei der Information ab. Dann sitzen wir einfach in diesem total überfüllten Wartezimmer. In der Zwischenzeit sind mindestens 5 neue Patientinnen gekommen. Nach einer weiteren halben Stunde werden dann sogar die Angehörigen (meistens Männer, teilweise auch mit Kindern) gebeten doch im Café zu warten, da die Plätze nun wirklich knapp werden.
Es war also richtig, richtig viel los und natürlich denkt man darüber nach, was die anderen Frauen an diesem Tag wohl in diese Klinik führt. Bei einigen kann man schon am Gesicht sehen, dass sie wohl die gleiche Geschichte haben wie ich. Man sieht den Schmerz der letzten Tage oder Wochen.
Und dann heisst es warten, warten, warten…es dauert bestimmt 2 Stunden, bis ich endlich zum Vorgespräch mit dem operierenden Arzt gerufen werde. Ich muss zugeben, dass mich das etwas mürbe gemacht hat. Mir geht es in solchen unangenehmen Situationen so: Augen zu und durch - und das bitte schnell.
So lange in diesem Wartezimmer zu sitzen und darüber nachzudenken, was jetzt kommt und wie alles ablaufen würde, war nicht gerade hilfreich.
Allerdings habe ich auch versucht es zumindest ein wenig positiv zu sehen, denn wenn eine Klinik so viele Patienten hat, dann muss die Arbeit der Ärzte wirklich gut sein. Also hat mir das volle Wartezimmer auch ein bisschen Mut gemacht, dass ich mich in die richtigen Hände begebe.
Das Vorgespräch und die OP
So war auch das Gespräch mit dem Arzt sehr angenehm. Mir wurde alles nochmal erklärt und ich konnte alle meine Fragen zur OP stellen. Insbesondere im Blick auf das sehr volle Wartezimmer, fand ich es toll, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich müsste mich beim Gespräch beeilen. Das hat mir in diesem Moment sehr gut getan. Auch die Ruhe, die der Arzt ausgestrahlt hat, war sehr wichtig für mich, denn ich lege ja irgendwie auch ein Stück meine Zukunft in die Hände dieses Mannes. Nach dem Gespräch ging es mir auf jeden Fall ein gutes Stück besser. Dann ging es wieder zurück ins Wartezimmer und nach einer weiteren halben Stunde warten ging es endlich los.
Eine sehr liebe OP-Schwester zeigte mir wo ich mich umziehen musste und ich bekam so einen tollen OP-Kittel…ja, diese schönen Teile, die vorne lang und hinten offen sind. Und dann ging auf einmal auch alles ziemlich schnell. Ich bekam ein Bett zugewiesen und konnte nur kurz in eine der Zeitungen schauen, bis auch schon die nächste Schwester kam und mich mit in den OP nahm.
Die Atmosphäre im OP war für mich immer komisch. Man steht irgendwie im Mittelpunkt und alle wuseln um einen herum und trotzdem steht man irgendwie neben sich. Mein Glück war an diesem Tag die Anästhesistin, die wirklich eine wundervoll liebevolle Art hatte. Ich kann mich bis heute eigentlich nur an sie erinnern und daran, dass sie es irgendwie hinbekommen hat, mich so in ein Gespräch zu ziehen, dass ich die ganzen Vorbereitungen der Narkose kaum mitbekommen habe.
Als das Narkosemittel langsam in meinen Arm gespritzt wurde, legte sie ihre Hand auf meine Schulter und sagte mir noch, dass alles gut ist und alle hier gut auf mich aufpassen würden….und dann gingen die Lichter auch schon aus. Noch heute kann ich mich daran erinnern, dass diese liebevolle Art mir einen großen Teil meiner Angst genommen hat. Diese Ärztin hat wirklich genau den richtigen Beruf ergriffen.
Aufgewacht bin ich dann wenig später in einem anderen Bereich der Klinik. Und auch hier arbeiteten wirklich so liebe und aufmerksame Krankenschwestern, dass ich mich wirklich „wohl“ gefühlt habe. Mir wurde sofort gesagt, dass alles gut gelaufen ist und ich bekam Zwieback, Salzgebäck und Tee, was auch wirklich nötig war, denn ich hatte langsam einen Bärenhunger. Bisher musste ich ja nüchtern bleiben und es war schon Mittagszeit. Für die Schmerzen, die nach dem Abklingen der Narkose aufkamen bekam ich eine Tablette und nun hieß es erstmal zur Ruhe kommen. Denn bevor ich gehen durfte musste ich noch 3 Stunden in der Klinik zur Beobachtung bleiben.
Die Leere danach
Ich war froh, dass alles gut gelaufen ist und ich es endlich hinter mir hatte und trotzdem war da plötzlich diese Leere. Denn bis vor einer Stunde war ein Teil meines Körper immer noch ein bisschen schwanger. Auch wenn mein Verstand schon länger wusste, dass es keine Hoffnung mehr gibt, war erst nach dieser OP wirklich alles vorbei und unser Krümel war nun fort. Ein schreckliches Gefühl, dass ich an diesem Tag so gut es ging versucht habe zu verdrängen. Ich habe alle meine Kraft zusammen gesammelt und habe versucht den Fokus nun endlich wieder nach vorne zu richten. Ich wollte wieder raus aus meinem depressiven Loch. Ich musste raus!
Denn ich wusste, dass es mir mit der Zeit immer schwerer fällt, mich aus so einer depressiven Phase wieder raus zu kämpfen. Je länger ich mich in solchen Situationen hängen lasse, desto tiefer versinke ich in Selbstzweifeln, Trauer und Wut und das wollte ich nicht mehr.
Ablenkung hilft
Und auch wenn ich nach der Ausschabung eigentlich nicht viel machen sollte, lag da auch ein großer Berg Arbeit vor mir. Denn zum 30.11.2013 wollten wir in unser Haus einziehen und bisher hatte ich durch die Fehlgeburt noch nichts geschafft um den Umzug vorzubereiten.
Körperlich war es sicher nicht ideal, jetzt mit Kisten und Kartons rumzuschleppen. Für meine Psyche war es aber ein Glück. Denn ich hatte etwas wo ich mich einfach reinwerfen konnte und wo der Kopf einfach mal Ruhe gab. Die nächsten zwei Wochen war ich also mit Einpacken in unserer Wohnung und mit Auspacken im Häuschen beschäftigt.
Dann kam die Weihnachtszeit, die ich wirklich so sehr liebe und wo es immer Dinge gab, die besorgt werden mussten. Natürlich war da auch der Gedanke, dass ich zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon die ersten Bewegungen im Bauch gespürt hätte. Eigentlich wollte ich doch mit einem kleinen runden Bauch unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Und doch haben wir es irgendwie geschafft, in dieser Zeit den Schmerz zur Seite zu legen und wieder positiv in die Zukunft zu schauen.
Die Untersuchung des Abortgewebes
Im Januar bekam ich dann endlich den Anruf meiner Ärztin, die mir den Befund der Untersuchung des Abortgewebes durchgab.
Wahrscheinlich hatte unser Krümel eine genetische Störung. Wobei im Befund nur von einem Verdacht gesprochen wurde. Das Gewebe an sich scheint also nicht genetisch untersucht worden zu sein.
Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass die meisten Fehlgeburten auf genetischen Ursachen beruhen und so war dies keine große Überraschung für mich. Ich hätte mir aber irgendwie doch einen Hinweis auf ein Problem gewünscht, irgendwas wogegen man hätte etwas tun können. So standen wir also irgendwie wieder ganz am Anfang.
Was sollten wir tun? Was könnte man verändern?
Wieder ein Arztwechsel
Um das heraus zu finden, wollten wir noch ein weiteres Mal den Arzt innerhalb unserer ersten Klinik wechseln. Denn eine Freundin war ebenfalls in der gleichen Klinik und hatte diesem Arzt ihren ersten Sohn zu verdanken. Bisher waren wir ja bei zwei relativ jungen Ärzten und wir hatten die Hoffnung, dass ein „alter Hase“ vielleicht doch ein bisschen mehr auf dem Kasten hätte.